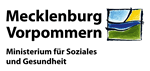Die Erhebung des psychischen Befundes gehört weder in der Praxis noch in der Klinik zum diagnostischen Alltag. Es ist deshalb sinnvoll, strukturiert vorzugehen, wie es zum Beispiel das Untersuchungsschema von Steinhausen (1993) vorschlägt:
| Psychopathologische Befunderhebung bei Kindern und Jugendlichen | |
| Äußeres Erscheinungsbild: | Attraktivität, Reife, Fehlbildungen, Kleidung, Sauberkeit |
| Kontakt- und Beziehungsfähigkeit: | Abhängigkeit von der Begleitperson, Aufnahme der Beziehung zum Untersucher, Selbstsicherheit, Kooperation |
| Emotionen: | Stimmung, Affekte, Angst, psychomotorischer Ausdruck |
| Denkinhalte: | Ängste, Befürchtungen, Phantasien, Denkstörungen, Selbstkonzept, Identität |
| Kognitive Funktionen: | Aufmerksamkeit, Orientierung, Auffassung, Wahrnehmung, Gedächtnis, allg. Intelligenz |
| Sprache: | Umfang, Intonation, Artikulation, Vokabular, Sprachverständnis |
| Motorik: | Aktivität, qualitative Auffälligkeiten wie Tics, Stereotypien, Jaktationen |
| Soziale Integration: | Position, Beziehungen innerhalb der Familie, Schulklasse, Freundeskreis |
Die Erhebung des psychischen Befundes ist die Voraussetzung dafür, seelische Störungen von Kindern angemessen einordnen zu können. Sie sollten Auffälligkeiten erkennen und benennen können und auch dokumentieren. In den Früherkennungsuntersuchungen im Kindesalter werden "Auffälligkeiten der emotionalen und sozialen Entwicklung des Kindes" kodiert.
Merkmale von misshandelten und vernachlässigten Kindern
In der Literatur zum Thema Kindesmisshandlung wird ein Merkmal als typisch für misshandelte Kinder beschrieben: Das Kind zeigt eine "gefrorene Aufmerksamkeit" (frozen watch-fulness). Es sitzt still auf seinem Platz und beobachtet seine Umgebung quasi aus dem Augenwinkel her aus, ohne sich zu bewegen. Es bewegt sich erst dann, wenn es sich unbeobachtet fühlt.
Als weitere typische Symptome für misshandelte Kinder werden emotionale Störungen (anhaltende Traurigkeit, Ängstlichkeit, Stimmungslabilität und mangelndes Selbstvertrauen) und Schwierigkeiten im Sozialverhalten beschrieben. Die Kinder sind entweder auffallend ruhig und zurückgezogen oder aber besonders aktiv, unruhig und schwierig (Aggressivität, Distanzlosigkeit). Bei der Entwicklungsbeurteilung findet man häufig Rückstände in der Motorik und Sprache.
Manchmal senden Kinder verschlüsselte Botschaften wie "Hier gefällt es mir" oder "Ich gehe gern ins Krankenhaus", die aussagen können, dass die Situation zu Hause schwer erträglich ist, ohne sie als solche zu benennen.
Manche Kinder, die in einer deprivierenden Umgebung leben, entwickeln sich in einer neuen Situation (während des Klinikaufenthaltes) rasch zum Positiven.
Auffälliges Verhalten des Kindes
Der Verdacht auf sexuellen Missbrauch entsteht manchmal durch auffälliges Verhalten des Kindes. Es zeigt inadäquates, sexualisiertes Verhalten oder nicht altersentsprechendes Wissen über Sexualität, das im Spiel oder in Zeichnungen dargestellt wird. Als Folge einer Missbrauchssituation kann eine plötzliche Verhaltensveränderung ohne ersichtlichen Grund entstehen.
Kinder meiden das Alleinsein mit einer bestimmten Person oder haben einen Schulleistungsknick, häufig verbunden mit sozialem Rückzug (internalisierendes Verhalten) oder unangemessener Aggressivität (externalisierendes Verhalten).
Einzelfund noch kein Beweis
Die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten sind keineswegs Beweise für eine Misshandlungs- oder Vernachlässigungssituation. Sie dienen allenfalls als Hinweise und können selbstverständlich auch andere Ursachen haben. Ein Arzt sollte bei diesen Befunden aber körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt gegen das Kind bzw. belastende Lebensumstände in die differenzialdiagnostischen Überlegungen einbeziehen.
Vermeiden Sie Suggestivfragen
Sollte es zu einem Gespräch mit dem Kind oder einer Betreuungsperson über den Verdacht auf Misshandlung bzw. Missbrauch kommen, ist für ein eventuell folgendes Strafverfahren vor allem Folgendes wichtig: Jede Befragung des Kindes, insbesondere eine suggestive Befragung, kann bezüglich einer späteren Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Kindes äußerst problematisch sein. Sie sollten deshalb in Ihrem Gespräch alles unterlassen, was als Suggestivfrage gewertet werden könnte. Wenn sich das Kind von sich aus mitteilt, so sollten dessen eigene Angaben schriftlich, wenn möglich wörtlich niedergelegt werden.
Sorgfältige Dokumentation
Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis der Untersuchung - auch zur Sicherung von Beweisen für ein etwaiges Strafverfahren - sorgfältig dokumentiert wird. Zu diesem Zweck wird insbesondere auf die im Serviceteil beiliegenden Untersuchungsbögen hingewiesen.
Seelische Gewalt
Seelische Gewalt und psychische Vernachlässigung können nur durch Verhaltensauffälligkeiten diagnostiziert werden. Diese Verhaltensauffälligkeiten sind allerdings nicht spezifisch für Misshandlung, sondern können viele andere Ursachen haben. Es gibt kein eindeutiges Merkmal und kein gesichertes diagnostisches Instrument, um seelische Gewalt zu erkennen.
Es ist jedoch möglich, zumindest einen Verdacht zu erhärten. In der Literatur werden eine Vielzahl von diagnostischen Hinweisen auf seelische Misshandlung gegeben, wenn organische Ursachen ausgeschlossen sind. Die meisten dieser Symptome sind auch bei sexuellem Missbrauch zu beobachten oder gehen mit körperlicher Gewalt einher (Eggers, 1994):
| Symptome bei seelischer Gewalt | ||
| Säuglingsalter | Kleinkindalter | Schulalter |
|
* Gedeihstörung * Motorische Unruhe * Apathie * "Schreikind" * Nahrungsverweigerung Erbrechen, Verdauungsprobleme * Psychomotorische Retardation |
* (Sekundäre) Enuresis * (Sekundäre) Enkopresis * Daumenlutschen * Trichotillomanie * Nägelbeißen * Spielstörung * Freudlosigkeit * Furchtsamkeit * Passivität, Zurückgezogensein * Aggressivität, Autoaggressionen * Distanzschwäche * Sprachstörung * Motorische Störungen und Jactationen |
* Kontaktstörungen * Schulverweigerung, Abnahme der Schulleistungen, Konzentrationsstörungen * Mangel an Ausdauer, Initiativverlust * Hyperaktivität, "Störenfried"-Verhalten * Ängstlichkeit, Schüchternheit, Misstrauen * Suizidgedanken, Versagensängste * Narzisstische Größenphantasien, Tagträumereien |
Zur Diagnostik kann ein Kinder- und Jugendpsychiater oder ein psychologischer Kinder- und Jugendpsychotherapeut hinzugezogen werden.